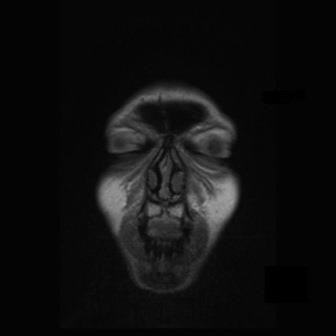13. April 17 | Autor: pluton | 0 Kommentare | Kommentieren
Ich stehe inmitten des weiten Feldes auf frischem erdigen Grund. Es riecht nach Regen, nach Laub und Natur. In naher Ferne, direkt am Feldrand, erblicke ich eine Reihe bunter Einfamilienhäuser, deren Farben sich vom blassen Blau des Frühjahrshimmel abheben. Das Sonnenlicht lässt die Kirchturmspitze leuchten. Obstbäume recken ihre kahlen Äste in die kalte Luft.
Das Dorf in der flachen Aue ist nie meine Heimat geworden. Es ist ihre Heimat. Ihre allein. Ich bin kein Teil mehr ihres Lebens, kein Teil ihrer Heimat.
Sechs Wochen oder sechs Jahre?
Meine Erinnerungen scheinen frei von Gefühlen. Als habe es nie eine gemeinsame Vergangenheit gegeben. Wie im Nebel verdämmern und verblassen alle Bilder. Was bleibt, ist Leere. Die Zeit ist in der Gegenwart stehengeblieben. Leben im Transit, ziellos unterwegs. Ich habe ihr ihr Lächeln genommmen. Ihr Blick ist kalt, anklagend, spöttisch, abweisend. Sie ist mir fremd geworden. Unüberwindbare Mauern haben sich aufgetürmt.
Ich fühle mich beengt in der erdrückenden Fürsorge des Dorfes, obwohl ich kein Teil seiner Gemeinschaft bin. Augen hinter jedem Fenster.
Wortlos stillen wir unseren Hunger in der dunklen Stube. Wir finden nicht mehr zueinander. Zerstörtes Vertrauen, zerstörte Nähe.
Als es dämmert, verlasse ich das Dorf. Das nie meine Heimat sein wird. Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl. Ich habe es verloren.
Das Dorf in der flachen Aue ist nie meine Heimat geworden. Es ist ihre Heimat. Ihre allein. Ich bin kein Teil mehr ihres Lebens, kein Teil ihrer Heimat.
Sechs Wochen oder sechs Jahre?
Meine Erinnerungen scheinen frei von Gefühlen. Als habe es nie eine gemeinsame Vergangenheit gegeben. Wie im Nebel verdämmern und verblassen alle Bilder. Was bleibt, ist Leere. Die Zeit ist in der Gegenwart stehengeblieben. Leben im Transit, ziellos unterwegs. Ich habe ihr ihr Lächeln genommmen. Ihr Blick ist kalt, anklagend, spöttisch, abweisend. Sie ist mir fremd geworden. Unüberwindbare Mauern haben sich aufgetürmt.
Ich fühle mich beengt in der erdrückenden Fürsorge des Dorfes, obwohl ich kein Teil seiner Gemeinschaft bin. Augen hinter jedem Fenster.
Wortlos stillen wir unseren Hunger in der dunklen Stube. Wir finden nicht mehr zueinander. Zerstörtes Vertrauen, zerstörte Nähe.
Als es dämmert, verlasse ich das Dorf. Das nie meine Heimat sein wird. Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl. Ich habe es verloren.