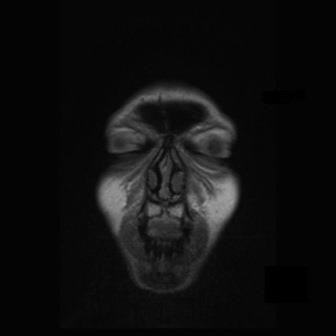08. Mai 17 | Autor: pluton | 0 Kommentare | Kommentieren
Von den ersten Morgenstunden an, in denen das Tageslicht zu dämmern begann, bis tief in die Nacht hinein habe ich die Zeit vor dem Fenster verbracht und den Himmel beobachtet. Eingefroren, erstarrt, kaum zu einer Bewegung fähig, als seien meine Muskeln und mein Gehirn auf sonderbare Art und Weise diskonnektiert. Ich habe das Licht der aufgehenden Sonne beobachtet, das langsame, zunächst fast unbemerkt in Erscheinung tretende Dämmern des Tageslichtes. War es vor einer Minute noch dunkel, so schien einen Augenblick später der Nachthimmel um Nuancen heller, bis schließlich der Sonnenaufgang die Welt zum Leben erweckte. Ich betrachtete die unendliche Reise der grau-weißen Wolken am blauen Himmel, das Tänzeln des Laubes in den Kronen der Bäume, das Treiben der Vögel. Gedankenleer, nur Assoziationen, die ich weder hinterfragte, noch verfolgte, als seien sie kein Teil meiner inneren Welt. Ich verspürte keinen Hunger, keinen Durst. Versunken wie in Hypnose ließ ich meine Gedanken, mein Leben an mir vorüberziehen, während ich diesem Schauspiel völlig unbeteiligt, wie ein Zuschauer im Theater, beiwohnte. Gegen Mittag war das Licht des Himmels am hellsten. Wolken, Vögel, ein Flugzeug zogen vorüber und bezeugten, dass die Zeit nicht stehen geblieben war. Ich vermisste die Menschen nicht. Weder ihre Nähe, noch ihre Gespräche. Ich begann, die Formen der Wolken zu interprestieren. Eine sah aus wie ein Hund mit einem wedelndem Schwanz, eine andere wie der Bodensee und wieder eine andere formte das Gesicht eines alten pfeiferauchenden Mannes nach. Am späteren Nachmittag bemerkte ich, dass das Tageslicht nachließ und die Abenddämmerung einsetzte. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich fast elf Stunden nicht vom Fleck gerührt. Nicht einmal die Toilette habe ich aufsuchen müssen. Ein Taubenpärchen ließ sich auf einem Ast im Baum vor dem Fenster nieder, brach jedoch bald wieder auf. Der völlige Reizentzug, dem ich mich aussetzte, ließ mich anfangen, über Probleme zu grübeln, über dieses und jenes, ohne dass ich einer Lösung dadurch näher gekommen wäre. Also besann ich mich und konzentrierte mich wieder auf die Form der Wolken, studierte den Flug der Vögel und beobachtete die Bewegungen der Blätter in den Kronen der Bäume. Als es Abend wurde, schienen die Bäume dunkler zu werden. Erst viel später verdämmerte das Licht des Himmels, dessen Blau sich zunehmend verdüsterte, erst grau-blau, schließlich grau-schwarz wurde. Die ersten Sterne wurden sichtbar und boten mir eine willkommene Abwechslung. Gegen Mitternacht stand ich schließlich auf. Meine Knochen schmerzten und ich fühlte mich kraftlos. Unsicher wankte ich durch das dunkle unbeleuchtete Wohnzimmer. Meine Kehle brannte nun vor Durst. Auf dem Weg zur Küche vermied ich einen Blick in den Spiegel. Ich trank ein Glas Wasser, dann noch eins. Zurück im Wohnzimmer, schaltete ich mein Mobiltelefon ein. Fünf Anrufe in Abwesenheit, drei Sprachnachrichten, vier Kurznachrichten. Mittlerweile war der Himmel pechschwarz und nur mühsam konnte ich noch die Konturen der Baumkronen erkennen. Ich nahm erneut Platz und hörte die Mailbox ab.
08. Mai 17 | Autor: pluton | 0 Kommentare | Kommentieren
Das gleißende Sonnenlicht spiegelt sich in den grau-blauen Wellen. Um mich herum die weite See, soweit das Auge reicht, in allen Himmelsrichtungen bis hin zum Horizont. Sonst nichts. Ein Meer aus Melancholie und Hoffnungslosigkeit. Heimatlos. Ohne Halt treibe ich umher. Nichts gehört zu mir und ich gehöre zu nichts. Die Einsamkeit ist mein einziger Begleiter, spendet keinen Trost, nährt nur die Leere in der Tiefe meiner Seele.
Der Wind bestimmt meine Richtung. Mal warm und sanft wie das Streicheln einer Hand, mal kalt und rau wie eine eisige Nacht im Winter. Kein Ziel in Sicht. Nur das tiefe dunkle Wasser um mich herum. Ich könnte springen, in die nassen kalten Fluten, mich ihnen hingeben, dass sie mich in die Tiefe reißen, mir Erlösung spenden aus dem immer gleichen trostlosen Lauf der Zeit.
Ich stelle mir vor einzutauchen, hinabgezogen zu werden. Ein letzter Blick durch das Wasser zur Oberfläche der See. Das Licht des Himmels wird schwächer, dunkler, verschwindet schließlich ganz. Schwarze Stille umgibt mich, die eisige Kälte des Wassers, die unendliche Tiefe des Ozeans. Rauschen in meinen Ohren, Sterne, Bilder und Szenen in bunten Farben vor meinen Augen, wie ein Film, der bald verschwimmt und verblasst. Für immer. Während ich meinen Frieden finde.
Der Wind bestimmt meine Richtung. Mal warm und sanft wie das Streicheln einer Hand, mal kalt und rau wie eine eisige Nacht im Winter. Kein Ziel in Sicht. Nur das tiefe dunkle Wasser um mich herum. Ich könnte springen, in die nassen kalten Fluten, mich ihnen hingeben, dass sie mich in die Tiefe reißen, mir Erlösung spenden aus dem immer gleichen trostlosen Lauf der Zeit.
Ich stelle mir vor einzutauchen, hinabgezogen zu werden. Ein letzter Blick durch das Wasser zur Oberfläche der See. Das Licht des Himmels wird schwächer, dunkler, verschwindet schließlich ganz. Schwarze Stille umgibt mich, die eisige Kälte des Wassers, die unendliche Tiefe des Ozeans. Rauschen in meinen Ohren, Sterne, Bilder und Szenen in bunten Farben vor meinen Augen, wie ein Film, der bald verschwimmt und verblasst. Für immer. Während ich meinen Frieden finde.
13. April 17 | Autor: pluton | 0 Kommentare | Kommentieren
Ich stehe inmitten des weiten Feldes auf frischem erdigen Grund. Es riecht nach Regen, nach Laub und Natur. In naher Ferne, direkt am Feldrand, erblicke ich eine Reihe bunter Einfamilienhäuser, deren Farben sich vom blassen Blau des Frühjahrshimmel abheben. Das Sonnenlicht lässt die Kirchturmspitze leuchten. Obstbäume recken ihre kahlen Äste in die kalte Luft.
Das Dorf in der flachen Aue ist nie meine Heimat geworden. Es ist ihre Heimat. Ihre allein. Ich bin kein Teil mehr ihres Lebens, kein Teil ihrer Heimat.
Sechs Wochen oder sechs Jahre?
Meine Erinnerungen scheinen frei von Gefühlen. Als habe es nie eine gemeinsame Vergangenheit gegeben. Wie im Nebel verdämmern und verblassen alle Bilder. Was bleibt, ist Leere. Die Zeit ist in der Gegenwart stehengeblieben. Leben im Transit, ziellos unterwegs. Ich habe ihr ihr Lächeln genommmen. Ihr Blick ist kalt, anklagend, spöttisch, abweisend. Sie ist mir fremd geworden. Unüberwindbare Mauern haben sich aufgetürmt.
Ich fühle mich beengt in der erdrückenden Fürsorge des Dorfes, obwohl ich kein Teil seiner Gemeinschaft bin. Augen hinter jedem Fenster.
Wortlos stillen wir unseren Hunger in der dunklen Stube. Wir finden nicht mehr zueinander. Zerstörtes Vertrauen, zerstörte Nähe.
Als es dämmert, verlasse ich das Dorf. Das nie meine Heimat sein wird. Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl. Ich habe es verloren.
Das Dorf in der flachen Aue ist nie meine Heimat geworden. Es ist ihre Heimat. Ihre allein. Ich bin kein Teil mehr ihres Lebens, kein Teil ihrer Heimat.
Sechs Wochen oder sechs Jahre?
Meine Erinnerungen scheinen frei von Gefühlen. Als habe es nie eine gemeinsame Vergangenheit gegeben. Wie im Nebel verdämmern und verblassen alle Bilder. Was bleibt, ist Leere. Die Zeit ist in der Gegenwart stehengeblieben. Leben im Transit, ziellos unterwegs. Ich habe ihr ihr Lächeln genommmen. Ihr Blick ist kalt, anklagend, spöttisch, abweisend. Sie ist mir fremd geworden. Unüberwindbare Mauern haben sich aufgetürmt.
Ich fühle mich beengt in der erdrückenden Fürsorge des Dorfes, obwohl ich kein Teil seiner Gemeinschaft bin. Augen hinter jedem Fenster.
Wortlos stillen wir unseren Hunger in der dunklen Stube. Wir finden nicht mehr zueinander. Zerstörtes Vertrauen, zerstörte Nähe.
Als es dämmert, verlasse ich das Dorf. Das nie meine Heimat sein wird. Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl. Ich habe es verloren.